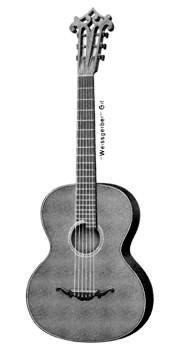| Wiener Modell |
| Heidi von Rüden |
| Das Wiener Gitarrenmodell ist ein im wesentlichen von Johann
Georg Stauffer (1778-1853) ausgebildeter Gitarrentyp mit längs
gewölbtem Boden und starker Einschnürung des Mittelbugs. Zudem
lassen sich sehr oft hochgewölbte Rippen feststellen. Viele
Instrumente wurden mit einer sogenannten Stauffermechanik
ausgestattet. |
 |
Stauffermechanik: 1825 von
Johann Georg Stauffer erfundene
Stimmmechanik: Wirbelplatte mit
asymmetrischem volutenartigem
Kopf (vgl. Voluten an frühen
Zithern), durch die Platte
geführten Wirbelstiften mit
Schneckengetriebe und
seitenständigen Wirbeln mit
Knopf; die Wirbel sind einreihig
auf der rechten Seite der
Wirbelplatte angeordnet.
Besonders die auffallend
starke Einschnürung der Taille, die sich in einem
Verhältnis von ca. 13:24 zur unteren Korpusbreite
bewegt, wurde zum Kennzeichen dieser klassischen
Gitarrenform. Neben Johann Georg Stauffer wurde das
Modell von einer Reihe weiterer in Wien ansässiger
Instrumentenbauer gefertigt: Johann Bucher (1972 zu
Hammerschwang in Württemberg -1856 in Wien), Joachim
Ehlers (Wien 1825), Bernhard I. Enzensperger (um 1780-um
1855), Johann Anton Ertl (Wien 1809. 1828), Friedrich
Schenk (Wien 1839. 1850). |
Gitarre, Johann. Georg
Stauffer, Halle, Händel-Haus, Inv.-Nr. MS-150
Lit.: Sasse 1972, S. 272f.; Heyde 1983, S. 108f. |
|
| "Demgegenüber weisen die alten Meister der gitarrenspielenden
Länder Spanien, Italien und
Frankreich eine abweichende,
mehr längliche Linienführung,
die, wie durch Vergleiche und
Versuche leicht festgestellt
werden kann, eine ganz andere
Tonfärbung zur Folge hat. Sie
alle besitzen einen weichen,
vollen, sonoren Klang gegenüber
dem mehr hellen, kurzen Klang
der Wiener Gitarren. Akustisch
ist dabei zu beachten, daß für
jede Tonschwingung die Längen
der Fichtenjahre, ähnlich wie
bei der gespannten Saite,
maßgebend sind. Werden diese
Längslinien durch das freilich
unentbehrliche Schalloch und
starke Tailleneinbuchtung
zerrissen, so kommen sie für
eine einheitliche
Längsschwingung nicht in
Betracht. Selbstverständlich
schwingen auch die kurzen Teile
und kommt eine Ausstrahlung des
Tones nach der Breite in Frage.
Diese Dauerschwingung bildet den
wichtigsten Klangfaktor der
Gitarre und ist entscheidend für
die Qualität des Tones. Daneben
kommen als weitere wichtige
Faktoren die Zargenhöhe, Form
und Lage der Tonbalken u. a. m.
in Betracht. Dieser Unterschied
läßt sich bei alten Instrumenten
ohne weiteres nachweisen.
Besonders auffallend ist er beim
Vergleich von zwei Terzgitarren
mit starker und geringer
Einschnürung"
(Schwarz-Reiflingen 1923, 25f.). |
|
Der Klang dieser Modelle wird durch die
Konstruktion beeinflußt.
Die Wiener Modelle von Richard Jacob weisen die
typischen Merkmale dieses Gitarrentyps, die 8-Form mit
einem stark eingezogenen Mittelbug auf. Auch an diesen
Modellen läßt sich Richard Jacobs meisterliche
Kunstfertigkeit ablesen. Er gibt ihnen einen
eigenwilligen Charakter durch besonders gestaltete
Kopfformen und dazu passenden geschnitzten Stegen.
Martin Jacob bemerkte dazu: "Außerdem gab es zu keiner
Zeit so viele Stegschmuckformen wie bei den Wiener
Modellen." (Martin Jacob 1988). Diese
Gestaltungsmerkmale fallen auf, da die Korpora der
Wiener Modelle eher schlicht gearbeitet wurden, d.h. mit
einfacher Randeinlage und Schallochumrandung. |
|
 |
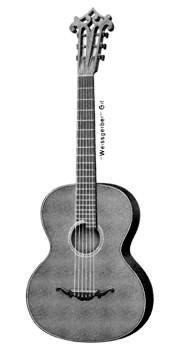 |
Richard Jacob beschreibt in seinem
Katalog verschiedene Wiener Modelle: das Wiener
Damen-Modell, das Herrenmodell, die Große Wiener
Konzert-Gitarre, eine Quint-Baß-Gitarre und eine
Terz-Gitarre. Diese Gitarren unterscheiden sich im
wesentlichen durch unterschiedliche Mensurlängen und
Korporagrößen. |
| Richard Jacob: Verkaufskatalog 1933, S.
4: "Nr. 45 Wiener Damen-Modell / Nr. 48 Große Wiener
Konzert-Gitarre" |
|
| Für den Entwurf der Wiener Modelle Richard Jacobs galten
vielleicht alte Wiener Instrumente als Vorlage. Die Konstruktion
Wiener Gitarren lernten Markneukirchner Gesellen (u.a. Karl August
Jacob) während ihrer Lehrzeit in der Werkstatt Stauffers kennen.
|
| Erwin Schwarz-Reiflingen (1923, 25f.) kommentierte diese
Beziehung zum vogtländischen Instrumentenbau so: "Nach Erlöschen von
Wiens ruhmreicher Generation von Gitarrenmachern, der Stauffer,
Schenk, Ertl, Enzensberger, Ehlert, Bucher u. a., nahm sie ihren Weg
Mitte des vorigen Jahrhunderts in den aufblühenden
Musikinstrumentenbezirk des sächsischen Vogtlandes mit
Markneukirchen als Hauptort. Bei den ersten Markneukirchner Gitarren
lassen sich noch ziemlich genau die Maße der Wiener Gitarren
feststellen, wenngleich die Arbeiten auch viel roher und
handwerksmäßiger sind. Die anfangs nicht üblen Gitarren wurden von
den späteren Generationen gedankenlos, serienweise nachgebaut und
verloren ihren Charakter." |
| Martin Jacob nennt zwei Veränderungen: "das Abheben des
Griffbrettes um einen besseren Ton zu schaffen und die Verwendung
von einem dauerhaften Bundmaterial: Neusilber." |
|
|
| Die Große Wiener Konzert-Gitarre ist das größte beschriebene
Modell. Laut Richard Jacob hat diese Gitarre eine Mensur von 65 cm
und die größte Breite des Korpus ist 40 cm. Das Museum besitzt 3
Modelle, die eine Mensurlänge von 625 mm haben. Es sind
Damen-Modelle. Die Gitarre mit der Inv.-Nr. 4759 hat 7 Saiten und
eine Mensurlänge von 632 mm. Die siebte Saite der Gitarre ist über
dem Griffbrett angebracht und kann auch in der Tonhöhe verändert
werden. Im Katalog Weißgerbers wird ein Wiener Modell als
Quint-Baß-Gitarre aufgeführt mit 1 freischwingendem Kontra D.
Quintbassgitarren sind nach Zuth (1978, S. 226): eine größere
Gitarreform in der Stimmung: A, – D – G – c – e – a mit einer Mensur
von etwa 70cm; neuerdings wird eine freischwebende Baßsaite
hinzugefügt. Um die Stimmung der Gitarre mit sieben Saiten zu
ermitteln wurden die Saitenstärken (wahrscheinlich sind die Saiten
original) gemessen. Demnach handelt es sich um die Stimmung einer
"Russischen Gitarre": D – G – H – d – g – h – d', die zu Beginn des
19. Jahrhundert in Russland sehr populär war und 7 Spielsaiten
besaß. |
| Als grundlegendes Prinzip wurde die Querbeleistung von Decke und
Boden angewendet. Der zweiteilige Boden der Gitarre wurde auch in
Längsrichtung stark gewölbt. Die Gitarren des Wiener Typs aus dem
frühen 19. Jh. hatten drei bis fünf Querleisten auf Decke und Boden.
Außerdem haben diese Gitarren einen Steckersteg. |
| Richard Jacob stattete die Decke in der
Regel mit fünf Querleisten aus. Zwei befinden sich
oberhalb des Schallloches und von den drei weiteren
Leisten ist eine unterhalb des Steges positioniert. Bei
der Gitarre mit der Inv.-Nr. 4759 fällt auf, dass die
zwei Leisten ober- und unterhalb des Steges nicht genau
waagerecht zur Mittellinie stehen, sondern leicht schräg
verschoben sind, auf der Diskantseite etwas höher als
auf der Baßseite. Bei allen Gitarren wurde der Steg
unterfüttert. Die Decken sind am Rand dünner als in der
Mitte, der Bereich vor dem Steg wurde zur Mitte
schwächer ausgearbeitet. Die Stärken schwanken bei der
Inv.-Nr. 4762 von 2,8 mm bis 3,1 mm und bei den Gitarren
Inv.-Nr. 4760 und Inv.-Nr. 4761 von 2,6 mm bis 3,0 mm.
Die Decke der Inv.-Nr. 4759 ist am meisten
ausgearbeitet. Am Rand teilweise nur 1,9 mm und in der
Mitte (auch oberhalb des Steges) 3,2 mm. |
 |
| Richard Jacob: Wiener Modell,
Markneukirchen 1923; Inv.-Nr. 4761 |
|
| Die Gitarren haben vier Bodenleisten, die etwa gleichmäßig über
den Boden verteilt sind. Diese wurden mit einer Höhe von 20 mm und
ca. 8 mm Breite gefertigt, um die starke Wölbung zu erhalten. |
| Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die Wiener Modelle etwas
schwerer, stärker und stabiler gebaut wurden als die anderen
Gitarren. Martin Jacobs Begründung für diese Bauweise lautete: durch
die Querbeleistung der Decke erhielt man einen kräftigen Ton, der
sich dann in jener Zeit bei der Schrammelgitarre bewährte" (Martin
Jacob 1988). Vielleicht wurden diese Instrumente später von den
Spielern als Schlaggitarren verwendet und mit Stahlsaiten bezogen,
wofür die Mechaniken mit Metallwellen an drei vorhandenen
Instrumenten sprechen. Als Korpusholz diente in der Regel geflammter
Ahorn, worauf auch im Verkaufskatalog hingewiesen wurde. |
|
Inhalt | Weißgerber-Gitarren:
Überblick | 4759 |
4760 |
4761 |
4762 |
| © STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2001 |